Was wirklich hinter körperorientierter Psychotherapie steckt – und warum der Unterschied entscheidend ist
Der Körper ist in aller Munde – aber wird er wirklich verstanden?
Körperarbeit boomt. Zum Glück. Endlich kommt die Bedeutung des Körpers auch in der Psychotherapie an. Die Themen Embodiment, Polyvagal Theorie und Achtsamkeit sind keine absurden Ideen mehr, sondern werden mehr und mehr auch in klassischen Psychotherapien als bedeutsam akzeptiert.
Tatsächlich ist die Arbeit mit Elementen der Körperarbeit noch keine Körperpsychotherapie.
Wichtig zu wissen ist:
- Körperpsychotherapie ist nicht einfach eine Technik, sondern ein ganzes Paradigma.
- Wer körperpsychotherapeutisch arbeitet, macht etwas anderes als Atemübungen oder Tools zur Selbstregulation einzusetzen.
Was Körperpsychotherapie nicht ist
Beginnen wir mit einer Klarstellung:
- Wer in seiner Sitzung eine Vagus-Übung anbietet, macht nicht automatisch Körperpsychotherapie.
- Wer Menschen beibringt, sich besser zu spüren, arbeitet nicht zwangsläufig körperpsychotherapeutisch.
- Und wer sagt: „Wir arbeiten auch mit dem Körper“, meint oft: Wir machen eine Intervention, aber kein strukturiertes körperbasiertes Vorgehen.
Viele sogenannte körperorientierte Tools sind symptomorientiert: Sie helfen zu regulieren, zu beruhigen, zu entspannen. Das ist wertvoll – aber es ist etwas anderes, als mit dem Körper als Ausdruck der Psyche zu arbeiten.
Verkörperte Erfahrungen und Gefühle sind etwas vollkommen anderes als die Körpersprache. Die Haltung oder Charakterstruktur ist etwas Permanentes, es ist der Ausdruck unserer Persönlichkeit. Es ist das, woran wir Freunde schon aus der Ferne erkennen, die Art und Weise, wie wir gehen, stehen und wie unser Körper in der Welt ist.
Diese Arbeit von Wilhelm Reich wurde von Alexander Lowen, Gerda Boyesen, David Boadella und vor allem auch durch Lisbeth Marcher und ihre Familie weiterentwickelt und therapeutisch verfeinert.
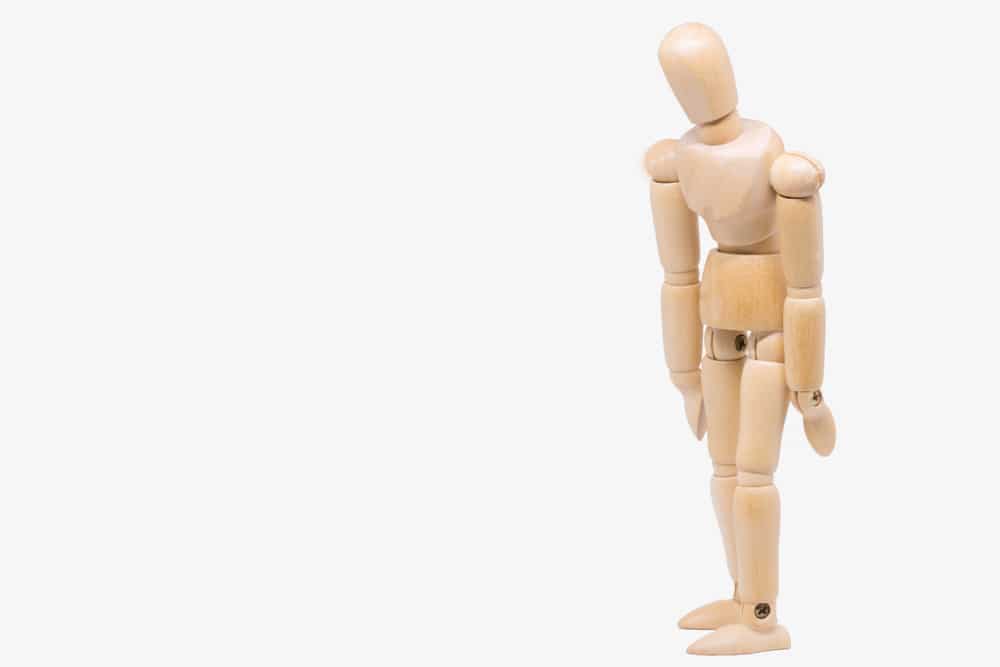
Heute spricht man nicht mehr vom Körperpanzer, sondern von der Charakterstruktur.
Vor 80 Jahren waren Menschen wesentlich gepanzerter als heute und man versuchte in der Körperpsychotherapie diese emotionale Panzerung “aufzubrechen” und Menschen mit ihren Gefühlen zu verbinden. Dazu gehörte oftmals z.B. die sehr katarthische Arbeit mit Wut, in der man Kissen verprügelte und schrie und tobte. Diese Art von Arbeit ist inzwischen überholt. Man weiß heute, dass für viele Menschen diese Art von Intervention eher schädlich ist, weil sie oft mit solchen Energien gar nicht umgehen können und die Wirkung dann eher kontraindiziert ist.
Körpersprache versus Körperstruktur
Ein zentraler Punkt in der Körperpsychotherapie ist die Unterscheidung zwischen
- Körpersprache: variabel, situationsabhängig, trainierbar (z. B. Gestik, Mimik, Blick)
- Körperstruktur: tief verwurzelt, meist unbewusst, über Jahrzehnte entstanden (z. B. kollabierter Brustkorb, steife Schultern, eingefallener Blick, „Soldatenhaltung“)
Körperstruktur ist wie ein psychobiografischer Fingerabdruck.
Sie erzählt uns, wie ein Mensch die Welt erlebt, was er gelernt hat zu vermeiden und wie er über sich selbst denkt.
Ein Beispiel:
Ein Mensch, der in seiner Kindheit nie Raum für eigene Impulse hatte, wird vielleicht mit festem Kiefer, zusammengezogenem Brustkorb und innerer Starre in die Welt gehen.
Die Struktur sagt: „Ich darf nicht viel Raum einnehmen. Ich bin zu viel.“
Und das bleibt – auch wenn der Kopf längst anderes sagt.
Es ist ein Problem der klassischen Gesprächstherapien, dass Menschen irgendwann zwar unglaublich viel über sich wissen, warum sie so sind, wie sie sind, sich ihre Muster aber nicht verändern. Der Körper ist sehr viel langsamer als der Verstand. Und nur weil wir etwas wissen, bedeutet das leider nicht, dass wir es „über den Verstand einfach so verändern können.
Der Körper als diagnostisches und therapeutisches Instrument
KörperpsychotherapeutInnen sehen und hören anders.
Sie achten nicht nur auf Worte, sondern auf das, was der Körper sagt – und oft widerspricht:
- Ein Mensch sagt: „Mir geht es gut.“
- Aber seine Schultern sind hochgezogen, der Atem flach, das Becken erstarrt.
- Der Körper sagt: „Ich bin im Alarmmodus.“
Körperpsychotherapie liest diese Signale – nicht als Symptom, sondern als Ausdruck eines biografisch entwickelten Musters. Und sie arbeitet mit ihnen: behutsam, respektvoll, über Spürbewusstsein, Bewegung, Atem, Berührung, inneres Erleben.
Dabei geht es nicht darum, etwas „wegzumachen“, sondern in Kontakt zu kommen mit den tieferen Schichten der Persönlichkeit, mit den verdrängten und dissoziierten Teilen unseres Selbst.
Es geht nicht um Anteile, sondern um über Muskulatur und Atem in Schach gehaltene, abgespaltene Gefühlen, die damals nicht auszuhalten waren.

Die chronischen Spannungsmuster in unserem Körper halten diese alten Gefühle weiter fest und sorgen dafür, dass wir funktionieren können.
Gleichzeitig verliert man mehr und mehr an Lebendigkeit.
In der Natur ist Starre = Tod.
Je starrer wir in unserem Körper sind, desto weniger flexibel und adaptiv können wir auf unser Leben reagieren und desto weniger fühlen wir Freude, Lust und Lebendigkeit. Menschen funktionieren dann nur noch.
Es geht nicht um Entspannung sondern um Integration
Körperpsychotherapie will nicht beruhigen, sondern erinnern, begreifen und verwandeln.
Es ist nicht wie bei einer Massage, die die Muskulatur lockern will. Körperpsychotherapie hilft uns, mit jenen Anteilen in Kontakt zu treten, die oft jenseits der Sprache existieren: frühe Bindungserfahrungen, implizite Überzeugungen, abgespaltene Emotionen.
Das Ziel ist nicht „Regulation“ als Endpunkt – sondern Integration, die zu einer Bottom-up-Regulation führt.
Je integrierter ein Mensch ist, desto
- mehr hat er Zugriff auf seine Ressourcen,
- bewusster ist er sich selbst,
- regulierter ist er,
- besser kann er sich ausdrücken, seine Bedürfnisse fühlen und kommunizieren
- weniger Energie braucht er, um die weggedrückten Gefühle zu kontrollieren.
Ein integrierter Mensch ist auch ein regulierter Mensch.
Also nicht: Wie werde ich ruhig?
Sondern: Wie komme ich in Kontakt mit dem, was ich immer vermeiden musste – und kann es verarbeiten und integrieren?
Struktur erzeugt Überzeugungen
Was viele nicht wissen: Die Körperstruktur formt auch unser Denken. Wir sind tatsächlich unser Körper. Je nachdem, welche chronischen Spannungsmuster wir in unserem Körper haben, so ist unsere Wahrnehmung von der Welt und von uns selbst.
Das klingt vielleicht etwas unglaublich, dennoch formen wir mit der Zeit, durch die sich wiederholenden Erfahrungen, die wir als Kinder machen, eine Brille. Für uns wird das, was wir durch unsere Brille sehen, zur Wahrheit. Für uns ist es wahr. Erst, wenn sich die Brille lockert, können wir eine andere Realität wahrnehmen.
Ich kann über mich sagen, dass meine Brille früher hieß: “Die Welt ist ein gefährlicher Ort”. Ich war zu 100% sicher, dass es so ist. Ich konnte ja überall die Bestätigung sehen. Durch meinen eigenen therapeutischen Weg hat sich diese Perspektive verändert. Ich sehe überall, wie freundlich Menschen meistens zu mir sind und fühle mich fast immer sicher. Das bedeutet nicht, dass ich naiv geworden bin und die Gefahren des Lebens nicht mehr wahrnehme. Sie sind nur ein Stück beiseite gerückt und es gibt Raum, auch die Schönheit und Freundlichkeit zu spüren und zu sehen.
Typische innere „Brillen“, die sich in bestimmten Strukturen wiederfinden, sind:
- Die Welt ist ein gefährlicher Ort.
- Ich bin anders und gehöre nicht dazu.
- Es gibt nie genug für mich.
- Ich brauche niemanden.
- Ich bin, wenn ich etwas leiste.
Diese Glaubenssätze sind körperlich gespeichert – nicht nur kognitiv.
Wer mit diesen Strukturen arbeitet, arbeitet auch mit den Überzeugungen. Aber nicht durch Überzeugungsarbeit, sondern durch Kontakt mit dem, was diese Überzeugungen einst notwendig gemacht hat.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenWarum das heute so wichtig ist
Wir leben in einer Zeit der Techniken. Alles muss schnell und effektiv sein. Kaum noch jemand nimmt sich Zeit für eine mehrjährige Psychotherapie oder auch psychotherapeutische Ausbildung. Aber der Mensch verändert sich nicht schnell.
Körperpsychotherapie hält dagegen. Sie ist langsam, beziehungsorientiert und radikal ehrlich.
Viele Menschen funktionieren – aber sie fühlen sich nicht mehr.
Sie atmen, regulieren, optimieren – aber sie verkörpern sich nicht.
Gerade deshalb braucht es in der Fachwelt mehr Klarheit, was mit „Körperarbeit“ gemeint ist.
Und den Mut, sich tiefer einzulassen.
Auf Prozesse.
Auf Resonanz.
Auf das, was der Körper noch weiß, wenn der Kopf längst verstummt ist.
Fazit: Der Unterschied macht den Unterschied
Lasst uns klarer sprechen, wenn wir von körperorientierter Arbeit sprechen.
Nicht aus Abgrenzung, sondern aus Respekt vor der Tiefe dieses Ansatzes.
Körperpsychotherapie ist nicht einfach ein Trend. Sie ist eine ebenso fundierte und alte psychotherapeutische Methode, die nicht nur über Sprache arbeitet, sondern den Körper und das, was er ausdrücken möchte, umfassend in den Blick nimmt und sieht.
Körperpsychotherapeuten können Klienten anders begegnen und abholen, weil sie an der Körperstruktur schon sehen können, mit welcher Brille dieser Mensch durch die Welt geht und welche Verletzungen er mit sich herumträgt.
Jede der Brillen hat eine Geschichte. Sie drückt aus, in welcher Entwicklungsstufe etwas gut oder nicht gut funktioniert hat. Was ein Mensch gut kann und wo er Schwierigkeiten hat. So kann ein Körperpsychotherapeut genau da ansetzen, worum es wirklich geht.
Körperpsychotherapie ist im besten Fall ein radikal beziehungsorientierter, tiefenpsychologisch fundierter Zugang zur Seele über den Körper.
Nicht: Was soll der Körper jetzt tun?
Sondern: Was erzählt er uns – über ein Leben, über Schutz, über Schmerz, über die Sehnsucht nach Kontakt?
Das ist Körperpsychotherapie.
Interessiert es dich, so mit Menschen zu arbeiten? In meiner Onlinefortbildung „Frühe Verletzungen und Entwicklungstrauma erkennen und heilen“ lernst du umfassend, wie du mit deinen Klientinnen und Klienten mehr Beziehung und Sicherheit herstellen kannst.
Trage dich jetzt für die kostenfreie Mini-Trauma-Fortbildung ein, die am 2. November wieder beginnt und in der du meine Arbeit unverbindlich kennenlernen kannst!

